
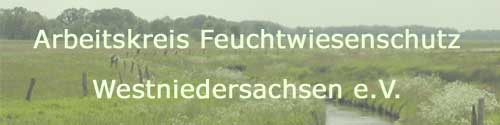

Feuchtwiesen
|
Der
Arbeitskreis Feuchtwiesenschutz Westniedersachsen legt sein Hauptaugenmerk
auf die Bestands- situation und –entwicklung typischer Vogelarten
der Feuchtwiesen. Doch was stellen Feuchtwiesen eigentlich aus botanischer
Sicht dar? Feuchtwiesen sind in erster Linie gekennzeichnet durch charakteristische Pflanzenarten, von denen einige hier in einem botanischen Überblick vorgestellt werden. |
 Wiesen-Schaumkraut
Wiese Wiesen-Schaumkraut
Wiese |
Entstehung
der Feuchtwiesen und ihre Gefährdung
Feuchtwiesen
sind in Niedersachsen zumindest großflächig erst durch anthropogenen
Einfluss entstanden. Bis ins frühe Mittelalter bestand die Vegetation
hier wohl überwiegend aus Mooren, Überschwemmungs- flächen
der Flüsse und v.a. Wäldern. Typische Feuchtwiesenpflanzen waren
deshalb vermutlich auf Bereiche beschränkt, die u.a. auch durch große
Herbivoren (z.B. Elch, Wisent, Wildpferd, Auerochse) offen gehalten wurden.
Dies waren auch die ursprünglichen Lebensräume unserer Wiesenvögel.
 Wasser-Greiskraut
Wiese Wasser-Greiskraut
Wiese |
Bis
dahin hatten die Menschen die Landschaft nur kleinflächig im
engeren Umfeld der Siedlungen beeinflusst. Durch eine dann einsetzende
Intensivierung des Holzeinschlages, der Waldhude (Waldweidennutzung)
und insbesondere von Waldrodungen zur Kultivierung entstanden großflächig
neue, offene Landschaftsräume. Auf feuchten bis nassen Standorten
haben sich die Feuchtwiesen entwickelt und mit diesen nahmen auch
die Wiesenvögel zu. |
Bereits ab Anfang des 19. Jahrhunderts, verstärkt aber nach dem 2. Weltkrieg, wurden die Feuchtwiesen durch Kultivierung und Melioration (Flurbereinigung, Tiefenumbruch, Drainierung), Ausbau, Begradigung und Vertiefung von Gräben großflächig in Vielschnittwiesen oder in ackerfähige Flächen umgewandelt. Diese tief greifenden Veränderungen führten zum Verschwinden vieler Charakterarten der Feuchtwiesen, andere sind in ihrem Bestand stark gefährdet bzw. zurückgegangen.
|
Anstelle
artenreicher Feuchtwiesen sind heute vielfach Hochgraswiesen, Um-
triebsweiden und Äcker vorherrschend, in denen alle Nässezeiger
ver- schwanden und durch Stickstoffzeiger ersetzt wurden. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken ist es wichtig Schutzgebiete auszuweisen oder über Vertragsnatur- schutzmaßnahmen landwirtschaftliche Flächen zu extensivieren. |
 Silagekette |
Fotos: Holger Oldekamp, AKFW